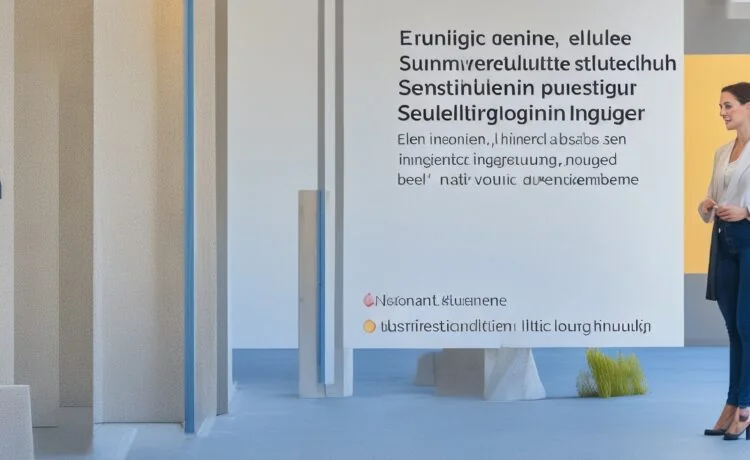Risse im Beton gehören zu den größten Herausforderungen auf Baustellen weltweit – mit enormen Kosten- und Umweltfolgen. Doch ein neues Zusammenspiel aus selbstheilendem Material und Künstlicher Intelligenz (KI) verspricht eine Antwort, die das Bauwesen revolutionieren könnte.
Beton am Limit: Warum Innovation dringend nötig ist
Beton ist das weltweit am meisten verwendete Baumaterial – und zugleich einer der größten Problemtreiber in Sachen Emissionen, Ressourcenverbrauch und Infrastrukturkosten. Allein die Zementherstellung verursacht etwa 8 % der globalen CO₂-Emissionen (Quelle: International Energy Agency, 2023). Zudem ist Beton anfällig für mikroskopische Risse durch Umgebungseinflüsse, die langfristig zu strukturellen Schäden führen, hohe Wartungskosten verursachen und neue Emissionen freisetzen.
Wissenschaftlerinnen und Ingenieure weltweit forschen deshalb intensiv an Betonen, die sich selbst regenerieren können. Das Prinzip: Der Beton enthält Mikroorganismen oder chemische Kapseln, die bei Rissbildung aktiviert werden und diese selbstständig wieder versiegeln. Neu ist jedoch, wie KI-gesteuerte Sensorik und Data Analytics dieses Konzept nun deutlich effektiver und skalierbarer gestalten.
Selbstheilender Beton trifft auf künstliche Intelligenz
Ein Team des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (IBP) in Zusammenarbeit mit Forschenden der ETH Zürich präsentierte im Frühjahr 2025 einen selbstheilenden Hochleistungsbeton, der auf bakteriellem Kalziumkarbonat basiert. Das Besondere: Eingebaute Sensorik sammelt kontinuierlich Daten über Feuchte, Temperatur und Mikro-Rissbildungen. Diese Daten werden per KI-Modell analysiert, um die Aktivierung des Heilungsvorgangs optimal zu steuern.
„Unsere KI reagiert nicht nur passiv auf Schäden, sondern lernt aus Umweltbedingungen, Lastprofilen und Materialverhalten – sie agiert vorausschauend“, erklärt Dr. Maya Kirsch, Projektleiterin bei Fraunhofer IBP. Ziel ist es, die Lebensdauer von Betonstrukturen signifikant zu erhöhen und Instandhaltungszyklen mithilfe prädiktiver Wartung zu optimieren.
Ein Meilenstein für Large-Scale-Infrastruktur: Brücken, Tunneldecken oder Windkraftfundamente im Offshore-Einsatz könnten künftig autonom Schäden erkennen, sich selbst regenerieren und ihre strukturelle Integrität melden – vernetzt über das Internet der Dinge (IoT).
Umwelt- und Klimavorteile: Nachhaltigkeit durch Innovation
Die Auswirkungen dieser Entwicklung sind enorm: In einer Studie der TU Delft aus dem Jahr 2024 wurde festgestellt, dass selbstheilender Beton den CO₂-Fußabdruck von Bauwerken um bis zu 30 % reduzieren kann, v. a. durch verlängerte Lebensdauer und Wegfall häufiger Reparaturen. Wird dieser Fortschritt mit einem KI-unterstützten Lifecycle-Management kombiniert, lässt sich die Ressourceneffizienz drastisch steigern.
Außerdem eröffnet der Ansatz neue Möglichkeiten für das zirkuläre Bauen. Bauteile, deren Zustand permanent überwacht wird, lassen sich gezielter wiederverwenden. Weniger Materialverbrauch heißt nicht nur weniger Emissionen, sondern auch geringere Kosten für Rohstoffe und Logistik.
Ein weiterer Vorteil: Wartungsarbeiten, besonders an kritisch exponierten Bauwerken wie Autobahnbrücken oder Staudämmen, lassen sich präziser planen. Das erhöht die Sicherheit und senkt die Gefahr von Ausfällen durch unerwartete Rissausbreitungen. In Europa entstehen jährlich Schäden an Infrastrukturbauten in Höhe von mindestens 25 Milliarden Euro (Quelle: EU-Kommission, Bauwirtschaftsbericht 2023). Viel Potenzial also für disruptive Einsparungen.
Wer sind die Köpfe hinter dieser Transformation?
Die Entwicklung des KI-gestützten Selbstheilbetons basiert auf interdisziplinärer Forschung. Dabei spielt das Kompetenznetzwerk „Digital Materials Europe“ eine zentrale Rolle. Neben Fraunhofer IBP und ETH Zürich sind auch Startups wie BetonIQ aus München beteiligt, die auf KI-gestützte Materialdiagnose mit Edge Computing spezialisiert sind.
Prof. Luca Santoro von der ETH Zürich betont in einem Vortrag auf dem diesjährigen Concrete Tech Summit in Berlin: „Wir sehen KI nicht als Add-on, sondern als integralen Bestandteil einer neuen Generation von Baumaterialien. Nur so lassen sich die Herausforderungen des Klimawandels und des demografischen Wandels im Bauwesen sinnvoll angehen.“
Auch große Bauunternehmen, darunter HOCHTIEF, Vinci und Skanska, zeigen Interesse. Erste Pilotprojekte sollen ab 2026 im Zuge neuer EU-Förderprogramme realisiert werden – insbesondere im Kontext nachhaltiger Smart-City-Lösungen.
Wirtschaftliche Auswirkungen: Was bedeutet das für die Branche?
Laut aktuellen Berechnungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) könnte der Einsatz von smartem Selbstheilbeton den Instandhaltungsaufwand im Tiefbau um bis zu 50 % verringern – bei gleichbleibender oder höherer Baustruktursicherheit. Das entlastet nicht nur Budgets, sondern verschiebt auch Investitionen: weg von Reparaturen, hin zu Innovationen.
Zudem lassen sich durch die kontinuierliche Datenerfassung neue Geschäftsmodelle etablieren: Anbieter können Wartungsservices als Datenpaket verkaufen oder Zustandsinformationen in Echtzeit an Infrastrukturbetreiber lizenzieren. So entsteht eine neue Wertschöpfungsebene an der Schnittstelle zwischen Bau- und Datenwirtschaft.
- Nutzen Sie Materialdaten bereits in der Planungsphase, um Wartungskosten exakt zu kalkulieren.
- Planen Sie Ressourcen für Predictive-Maintenance-Systeme proaktiv ins Budget ein – sie amortisieren sich in der Regel innerhalb von 3–5 Jahren.
- Verfolgen Sie aktuelle Förderprogramme für KI-basierte Bauprojekte, z. B. das EU-Initiative „Digital Construction for Green Europe“.
Fazit: Kommt jetzt der Bau der Zukunft?
Selbstheilender Beton in Kombination mit KI könnte zum Gamechanger in der Bauindustrie werden – nicht nur aus technischer, sondern auch aus ökologischer und wirtschaftlicher Perspektive. Was früher wie Science-Fiction klang, wird durch datengetriebene Werkstoffforschung und Digitalisierung zunehmend Realität. Die Bauindustrie steht mit dieser Entwicklung an einem Wendepunkt zu mehr Resilienz, Effizienz und Nachhaltigkeit.
Welche Erfahrungen haben Sie mit innovativen Baumaterialien gemacht – in Planung, Praxis oder Forschung? Diskutieren Sie mit der Community in den Kommentaren und teilen Sie Ihre Erkenntnisse zu KI im Bauwesen!