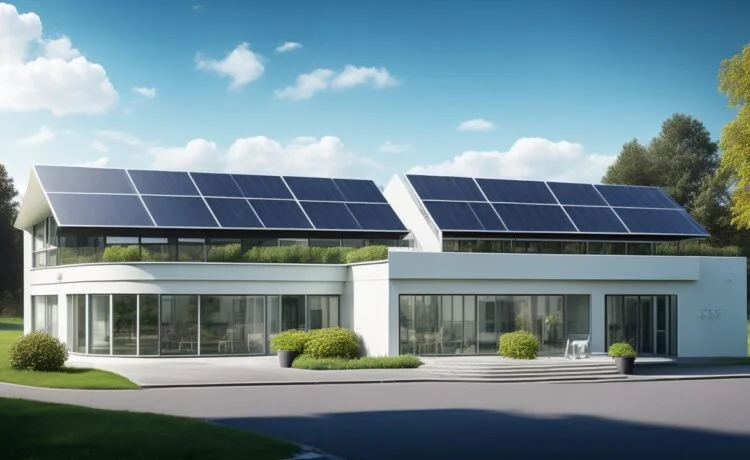In Sachsen-Anhalt entsteht ein Rechenzentrumsprojekt der Superlative: SBB Bytefortress plant ein hybrides Datacenter mit integrierten Batteriespeichern. Das Vorhaben steht sinnbildlich für den Strukturwandel der digitalen Infrastruktur in Deutschland – und vereint Energieeffizienz, Skalierbarkeit und regionale Wertschöpfung.
Ein Hybridmodell als Zukunftsformel: Das Bytefortress-Projekt im Überblick
Mitten in Sachsen-Anhalt, im Industriegebiet bei Köthen (Anhalt), entwickelt der Hamburger Projektierer SBB Bytefortress ein neuartiges Rechenzentrum, das auf hybrider Architektur basiert. Geplant sind nicht nur hochverfügbare Rechenkapazitäten, sondern auch ein modernes Energieversorgungskonzept: Rund 50 MW Batteriespeicherleistung sollen installiert werden, um die Energieversorgung zu stabilisieren und Peak-Stromkosten zu senken. Das Projekt, das eine Investitionssumme im dreistelligen Millionenbereich umfasst, bringt neue Dynamik auf den Telekom- und Infrastrukturmarkt in Ostdeutschland.
Der Projektstart ist für Anfang 2026 angesetzt, die Inbetriebnahme des ersten Moduls voraussichtlich Mitte 2027. Bytefortress arbeitet dabei eng mit lokalen Versorgern und kommunalen Entwicklungsagenturen zusammen. Der Standortvorteil: günstige Strompreise, Netzanbindung an das 110-kV-Netz und ausreichend Platz für Skalierung.
Was macht dieses Rechenzentrum „hybrid“?
Das Bytefortress-Datacenter verfolgt einen bimodalen Betriebsansatz: Zum einen wird klassische Co-Location angeboten – mit modularem Rackhousing für Businesskunden, zum anderen entstehen dedizierte Cloud-Infrastrukturen (private und hybride Cloudinstanzen), die dynamisch skalierbar sind. Der Clou liegt jedoch in der Energieversorgung: Parallel zum Rechenzentrumbetrieb wird eine großtechnische Lithium-Ionen-Batteriespeicherfarm betrieben, die bidirektional mit dem Stromnetz interagiert.
Diese Kombination ermöglicht sogenannte „Grid-Interactive Data Centers“. Beim Stromüberangebot speisen die Batteriespeicher überschüssige Energie ein und entlasten das Netz – bei hoher Auslastung puffern sie Verbrauchsspitzen. Studien des Borderstep Instituts belegen: Derartige Hybridmodelle können bis zu 30 % Netzlast glätten und Energiekosten um bis zu 20 % senken (Quelle: Borderstep Institut, 2023).
Technologische Meilensteine: Modularität, KI-Monitoring und Edge-Funktionalität
Die Infrastruktur basiert vollständig auf modularen Einheiten, die sich – ähnlich rollenden Blöcken – einzeln skalieren, umrüsten oder sogar mobil versetzen lassen. Jeder Rechenzentrums-Container wird mit einer eigenen Kühl- und Energieeinheit ausgerüstet und über ein zentral gesteuertes KI-basiertes Energiemanagementsystem koordiniert. Diese Form der Steuerung erlaubt die intelligente Lastverteilung zwischen Compute-, Speicher- und Batteriekomponenten – und berücksichtigt dabei Netzlastprognosen sowie Strompreisentwicklung in Echtzeit.
Überdies verfügt das Bytefortress-Zentrum über Edge-Computing-Funktionalitäten: Lokale Datenverarbeitung vor Ort ermöglicht Latenzen unter 10 Millisekunden – ein entscheidender Vorteil für Anwendungen aus Industrie 4.0, halbautonome Verkehrssteuerung oder medizinische Diagnostik.
Bis 2028 sollen insgesamt vier Cluster mit je 10 MW IT-Last entstehen – unter Einsatz klimaneutraler Kühlmethoden wie adiabatischer Rückkühlung und Wärmerückgewinnung. Derartige Anlagen entsprechen dem europäischen „Climate Neutral Data Centre Pact“.
Nachhaltigkeit und Standortvorteil: Warum Sachsen-Anhalt?
Das Land Sachsen-Anhalt hat sich in den letzten Jahren strategisch als Standort für Großinfrastruktur neu aufgestellt. Mit Initiativen wie dem „Digital Infrastructure Investment Hub (DIIH)“ und gezielten Förderprogrammen lockt das Bundesland technologieorientierte Investoren an. Dabei spielt die Nähe zu Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien – insbesondere Windkraft – eine zentrale Rolle.
Aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes zufolge deckt Sachsen-Anhalt bereits über 65 % seines Strombedarfs aus Erneuerbaren (Stand 2024). Für ein Strom-intensives Rechenzentrum wie Bytefortress ist das ein entscheidender Standortvorteil – ökologisch wie ökonomisch.
- Förderung nutzen: Unternehmen sollten beim Bau oder der Anmietung von Rechenzentrumskapazitäten gezielt regionale Fördermittel prüfen.
- Lastspitzen ausgleichen: Die Integration von Batteriespeichern kann die Stromkosten signifikant senken – besonders bei Co-Location-Angeboten.
- Edge-Strategien frühzeitig planen: Anwendungen mit niedriger Latenz profitieren enorm von verteilten, modularen Rechenzentrumsstrukturen.
Statistik: Laut Bitkom (Cloud Monitor 2024) nutzen bereits 69 % der deutschen Großunternehmen hybride Cloud-Architekturen – mit steigender Tendenz (+5 Prozentpunkte gegenüber 2023). Die Nachfrage nach hochverfügbarer, aber dennoch dezentral betreibbarer Cloud-Infrastruktur nimmt laut IDC jährlich um rund 11 % zu (Quelle: IDC Data Center Trends 2024).
Chancen und Herausforderungen für die Telekommunikationsbranche
Das Bytefortress-Vorhaben könnte den Telekommunikationsmarkt nachhaltig verändern. Denn mit sich zunehmend dezentralisierenden Dateninfrastrukturen verschieben sich auch die Anforderungen an Netzanbieter, Interconnectivity-Hubs und Peering-Strukturen. Hybride Datacenter wie in Sachsen-Anhalt könnten künftig auch in ländlicheren Regionen neue Knotenpunkte für Highspeed-Datenverarbeitung etablieren und so die Notwendigkeit teurer, zentralisierter Backbones verringern.
Eine Herausforderung bleibt allerdings: die unterbrechungsfreie Anbindung an leistungsstarke Glasfasertrassen sowie die Integration in bestehende Carrier-Backbones. Hier bedarf es Standardisierung und Allianzen mit Netzbetreibern, um eine durchgängige SLA-Abdeckung zu garantieren.
Experten des eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. betonen zudem, dass hybride Rechenzentren neue Anforderungen an digitale Sicherheitsstrategien stellen, da sie kritischen Infrastrukturstatus erlangen könnten.
Industrie 4.0, KI und die Rolle hybrider Datacenter
Für industrielle, KI-gestützte oder regulatorisch sensible Anwendungen bieten hybride Rechenzentren höchste Flexibilität. Die Kombination aus lokaler Prozessverarbeitung und Cloud-Skalierbarkeit bildet die IT-infrastrukturelle Grundlage für datengetriebene Produktionsketten, automatisiertes Monitoring oder individualisierte Services.
Gerade mittelständische Unternehmen, die teils eigene Edge-Komponenten betreiben, aber dennoch Public-Cloud-Ressourcen nutzen wollen, profitieren vom neuen Datacenter-Modell: Komplexe Daten bleiben lokal, Standarddienste wandern in die Cloud.
Langfristig entsteht so eine Infrastrukturstruktur mit „Cloud at the Edge“ – und jene Regionen, die als Digitalstandorte bislang unterrepräsentiert waren, könnten digitale Vorreiter werden.
Fazit: Ein Rechenzentrumsprojekt mit Signalwirkung
Das Bytefortress-Projekt zeigt eindrucksvoll, wie Digitalisierung, Energiewende und Regionalentwicklung ineinandergreifen können. Die Kombination aus Hightech, Nachhaltigkeit und Standortstärkung hebt hybride Rechenzentren auf ein neues Niveau – mit Potenzial zum Blaupause-Modell für Europa.
Wer jetzt in Infrastruktur investiert, sollte den Trend zur Hybridisierung nicht länger ignorieren. Die Community ist eingeladen, ihre Einschätzungen, Ideen oder Anwendungsbeispiele zu hybriden Datacenter-Modellen zu teilen und gemeinsam die Zukunft digitaler Infrastrukturen mitzugestalten.