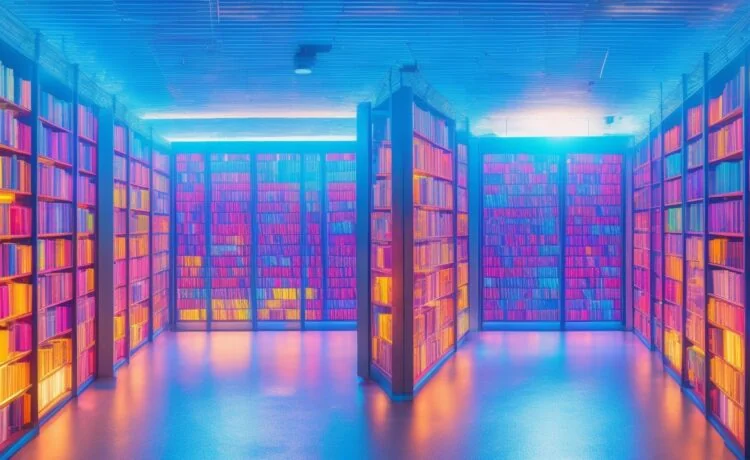Künstliche Intelligenz verändert die Informationslandschaft radikal – auch in Bibliotheken, die traditionell als verlässliche Wissenshüter gelten. Doch was passiert, wenn Nutzer generative KI-Systeme als Ersatz für bibliothekarische Expertise wahrnehmen? Der folgende Artikel beleuchtet Chancen, Risiken und Perspektiven für Bibliotheken im Zeitalter KI-generierter Inhalte.
Der Wandel des Informationsverhaltens
Bibliotheken stehen heute vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits sollen sie digitale Innovationen wie KI aktiv nutzen, andererseits müssen sie gegen die zunehmende Verbreitung von Desinformation ankämpfen – häufig verursacht durch sogenannte „halluzinierende“ KI-Modelle. Der Wandel im Informationsverhalten ist tiefgreifend: Immer mehr Menschen, insbesondere jüngere Generationen, wenden sich zuerst an KI-Dienste wie ChatGPT, Perplexity.ai oder Google Bard, bevor sie auf klassische Informationsquellen zurückgreifen.
Dies lässt sich durch aktuelle Nutzungszahlen belegen: Laut einer Umfrage des Pew Research Center (2024) nutzen 56 % der Internetnutzer in den USA regelmäßig generative KI für die Beantwortung von Informationsfragen. In Deutschland liegt der Anteil laut Bitkom (2024) bei rund 38 %, Tendenz steigend.
Die Gefahr der KI-Halluzination
Eines der zentralen Probleme generativer Sprachmodelle wie GPT-4 oder LLaMA liegt in ihrer Tendenz, plausible, aber faktisch völlig falsche Informationen zu erzeugen – ein Phänomen, das als „Halluzination“ (engl.: hallucination) bezeichnet wird.
Ein bekanntes Beispiel: 2023 wurde ein Anwalt in den USA verurteilt, weil er in einem Schriftsatz mehrere angebliche Gerichtsentscheidungen zitierte, die von ChatGPT erfunden wurden. Auch in wissenschaftlichen Kontexten hat sich gezeigt, dass KI-Modelle häufig Quellen erfinden oder unechte Zitate erzeugen – ein Albtraum für wissenschaftlich arbeitende Bibliotheken und Bildungseinrichtungen.
Diese Entwicklungen gefährden nicht nur die Informationsqualität, sondern auch die Reputation von Bibliotheken, wenn Nutzer ungeprüft KI-generierte Inhalte für vertrauenswürdig halten und zugleich auf professionelle Informationsdienste verzichten.
Bibliotheken zwischen Vertrauen und Kontrollverlust
Viele Bibliotheken berichten bereits von einer gesteigerten Unsicherheit bei Nutzerinnen und Nutzern, die KI-generierte Informationen mit Verweis auf scheinbar authentische Quellen präsentieren. Das Problem verstärkt sich, wenn Schulung und Informationskompetenz nicht mehr mit dem Tempo der technologischen Entwicklungen Schritt halten. Besonders prekär: Selbst hochgebildete Nutzer sind nicht immer in der Lage, zwischen verifizierten Quellen und KI-generierten Fälschungen zu unterscheiden.
Ein zentrales Dilemma: Bibliotheken sind prädestiniert für evidenzbasiertes Arbeiten, verlieren jedoch an Relevanz, wenn der Zugang zu Informationen primär KI-gesteuert erfolgt. Laut dem „OCLC Global Library Survey 2024“ nennen Bibliotheken weltweit die wachsende Infragestellung ihrer Rolle als kuratierende Instanz als größte strategische Herausforderung.
Wie KI sinnvoll in Bibliotheksarbeit integriert werden kann
Trotz aller Bedenken sind generative KI-Tools nicht per se negativ. Vielmehr bieten sie Bibliotheken Potenziale für Automatisierung, Effizienzsteigerung und neue Services. Einige Vorreiter gehen mit gutem Beispiel voran: Die British Library arbeitet seit 2023 mit KI-gestützter Metadatengenerierung, um große digitalisierte Sammlungen einfacher durchsuchbar zu machen. Die Staatsbibliothek zu Berlin testet KI-basierte Inhaltserschließung in Digitalisaten historischer Manuskripte.
Auch im Bereich der Nutzerorientierung können Chatbots auf Basis sicher trainierter Modelle einfache Auskunftsdienste übernehmen, etwa zu Öffnungszeiten oder zur Nutzung von Katalogen – wohlgemerkt mit entsprechender Supervision durch Fachpersonal. Wichtig ist dabei, zwischen vertrauenswürdiger KI-Anwendung im Backend und transparenter Kommunikation gegenüber den Nutzenden zu unterscheiden.
Damit Bibliotheken den digitalen Wandel aktiv gestalten können, empfehlen sich folgende Maßnahmen:
- Informationskompetenz fördern: Bibliotheken sollten verstärkt Workshops zur kritischen KI-Nutzung anbieten, etwa zur Bewertung von Quellen, Nachvollziehbarkeit von KI-Antworten und Erkennen von Halluzinationen.
- Sichere KI-Infrastruktur aufbauen: Der Einsatz von Open-Source-Modellen wie Mistral oder Claude in lokaler Umgebung eröffnet Möglichkeiten für datensouveräne Wissensdienste ohne Abhängigkeit von US-Anbietern.
- Kooperationen vertiefen: Enge Zusammenarbeit mit Hochschulen, Tech-Partnern und Forschungsinstituten ist essenziell, um KI-Ethik, Transparenz und Qualitätssicherung gemeinsam zu entwickeln.
Strategien gegen Desinformation und KI-Fehlinformation
Ein umfangreiches Aufgabenfeld ergibt sich aus der zunehmenden Verbreitung von KI-generierter Desinformation. Bibliotheken – insbesondere öffentlich-rechtliche und akademische – sind gefragt, sich als „Trusted Information Providers“ sichtbar zu positionieren. Dazu gehören:
- Verlinkung qualitätsgesicherter Inhalte: KI-generierte Texte sollten durch externe, geprüfte Inhalte ergänzt oder verifiziert werden. Bibliotheken können hierzu APIs anbieten, die auf Open-Access-Inhalte zugreifen.
- Auditing von KI-Antworten: Mit Tools wie „Grounded Generation“ lassen sich KI-Outputs in Echtzeit mit verlinkten Quellen gegentesten. Pilotprojekte zeigen vielversprechende Ergebnisse.
- Präsenzen in KI-Ökosystemen aufbauen: Bibliotheken sollten sich aktiv daran beteiligen, Schulungsmaterial, geprüfte Datenquellen und Metadaten in LLM-Projekte einzuspeisen, etwa über Wikimedia, Open Data-Portale oder durch eigene Git-Repositories.
Eine Besonderheit liegt zudem in der Möglichkeit, über sogenannte „Retrieval-Augmented Generation“-Systeme (RAG) Inhalte aus Bibliothekskatalogen als Faktengrundlage für KI-ba sierende Anwendungen nutzbar zu machen – vorausgesetzt, eine passende Infrastruktur existiert. Hier eröffnen sich Zukunftsperspektiven für datengetriebene Bildungssysteme, bei denen Bibliotheken eine zentrale Rolle spielen.
Fazit: Zwischen Vermittlung und Verantwortung
Die Zukunft von Bibliotheken wird wesentlich davon abhängen, ob sie es schaffen, nicht nur digitale Dienste zu integrieren, sondern auch als kompetente Instanzen im Umgang mit KI aufzutreten. In Zeiten, in denen Text- und Informationsproduktion algorithmisch generiert wird, ist bibliothekarische Qualitätssicherung wichtiger denn je.
Dies erfordert ein Umdenken – weg von der reinen Sammlung hin zur aktiven Vermittlung von Informationskompetenz, Medienverstehen und KI-Transparenz. Bibliotheken können und sollten zu kritischen Orten für gesellschaftlichen Diskurs über künstliche Intelligenz werden.
Wie sehen Sie die Rolle Ihrer Bibliothek in diesem Wandel? Welche Erfahrungen haben Sie mit KI-generierten Inhalten gemacht – positiv wie negativ? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren oder teilen Sie diesen Artikel in Ihrem Netzwerk. Es ist Zeit, die Zukunft der Informationskompetenz gemeinsam zu gestalten.